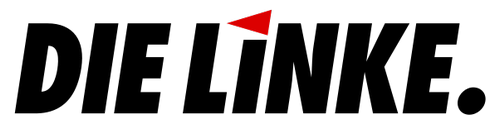An sich begrüßen wir, dass die Partei sich in der Leipziger Erklärung auf den Gründungskonsens der Linken zurückbesinnt und einleitend klarstellt, dass die seinerzeit im Parteiprogramm beschlossenen Grundsatzpositionen weiterhin Leitlinien unseres Handelns sind. Damit dürfte klargestellt sein, dass Forderungen etwa nach Waffenlieferungen in die Ukraine künftig zu unterlassen sind – oder doch nicht?
Was hat die Aussage zu bedeuten, dass DIE LINKE „mit der immer sichtbareren Klimakatastrophe, dem notwendigen Ende des fossilen Kapitalismus, zunehmenden imperialen Rivalitäten zwischen USA-Russland-China, dem Erstarken einer extremen Rechten in Europa und schließlich dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine“ auf zentrale Fragen „unzureichend vorbereitet“ war und daher unsere Positionen „weiterentwickelt“ werden müssen? Auch wenn wir diesen – zaghaften – Ansatz zur Selbstkritik begrüßen, halten wir die Analyse für falsch. Unser Parteiprogramm liefert auch auf diese Fragen zwar keine umfassenden Antworten, aber doch eine klare Richtschnur, die auf dem Nachkriegskonsens beruht, Kriege durch internationale Chartas auf dem Verhandlungswege zu verhindern bzw. zu beenden. Diese wird von den etablierten Parteien allerdings nicht geteilt und wir sehen unser Kernproblem darin, dass auch zunehmend große Teile des linken Parteiestablishments es aufgegeben haben, sozialistische Positionen sowie Friedenspositionen inhaltlich kompetent und selbstbewusst zu vertreten. Die neoliberale Zermürbungstaktik trägt Früchte.
Zwar werden in der Leipziger Erklärung einige Gemeinsamkeiten aufgezählt – Stärkung des Öffentlichen, Umverteilung, Investitionswende, Abrüstung und Entspannungspolitik, Kampf gegen rechts – aber reichen ein paar Begriffe und Allgemeinplätze aus, um in den aktuellen Auseinandersetzungen Position zu beziehen? Reicht dies aus, um tatsächlich die zunehmend bedrohlichen Verhältnisse zu verändern?
„Angesichts aller Krisen und dem Versagen der Ampel-Regierung sind linke Antworten mehr denn je gefordert“ – dem stimmen wir voll zu, aber wie sehen diese linken Antworten aus?
Setzen wir uns für selbstbewusst für einen Kompromissfrieden ein und sprechen uns gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete aus oder weichen wir bei Nachfragen lieber aus, stimmen in eine vermeintliche Alternativlosigkeit der NATO-Westbindung ein oder unterstützen gar das – nur mit mehr Waffenlieferungen zu erreichende – Kriegsziel der militärischen Rückeroberung der Krim durch die Ukraine? Lehnen wir eine Sanktion wie das Ölembargo ab, fordern wir eine vorübergehende Ausnahme Ostdeutschlands oder nicht einmal das? Wollen wir uns als soziale Opposition gegen den Kurs der Ampel profilieren oder doch lieber dabei mitwirken, den unsozialen Zumutungen ein angeblich „progressives“ Mäntelchen umzuhängen – etwa indem wir die Verstaatlichung von Uniper und damit verbundene Sozialisierung von über 50 Mrd. Euro an Verlusten (die ohne den Verzicht auf die Inbetriebnahme von Nord Stream II womöglich gar nicht entstanden wären) als fortschrittliche „Vergesellschaftung“ verklären? Führen wir den Kampf gegen rechts, indem wir die Interessen der Beschäftigten und sozial Abgehängten konsequent vertreten und uns an sozialen Protestaktionen gegen steigende Energiepreise beteiligen (sofern sie nicht von der AfD o. anderen rechten Organisationen initiiert werden) oder unterstützen wir Innenministerin Nancy Faeser dabei, Proteste gegen die Energie- und Außenpolitik der Ampel pauschal in die rechte Ecke zu stellen? Was setzen wir dem Bürgergeld oder der Aktienrente der Ampel entgegen – ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eine Reform der Arbeitslosen- und Rentenversicherung?
Dies und vieles mehr bleibt unklar. Die teils unvereinbaren Widersprüche sollten wir mutig benennen und die Konsequenzen der jeweiligen Tendenz offen besprechen. Dazu ist diese Leibziger Erklärung aber nur in sehr beschränktem Maße hilfreich. Eine Partei, die in zentralen aktuellen Fragen der Außenpolitik, der Wirtschaftspolitik, der Innen- und der Sozialpolitik keine gemeinsamen Überzeugungen mehr vertritt, wird es aber schwer haben, andere von sich zu überzeugen.
Bild: Kemfar (CC BY-SA 4.0)