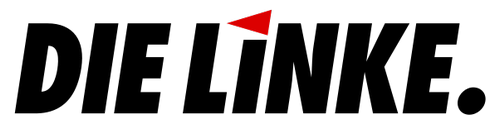Vier Vorschläge von Benjamin Opratko, was SozialistInnen hierzulande vom globalen Aufschwung des Linkspopulismus lernen können.
Jemanden „Populisten“, „Populistin“ zu nennen, heißt ihn oder sie zu schmähen: als Demagogin, Nationalistin oder Rassisten. Lange wurde die Bezeichnung in Europa auf die radikale Rechte gemünzt. Doch seit einigen Jahren dient sie auch der Desavouierung linker PolitikerInnen. CDU-Generalsekretär Tauber gilt die LINKE als „rote AfD“. Und in der europäischen Presse wurde die Wahl des Neoliberalen Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten nicht selten als Absage an den „rechten“ wie den „linken“ Populismus gefeiert – als wären Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon bloß zwei Ausprägungen eines im Kern gleichen politischen Projekts.
So verwendet hat der Populismusbegriff sozialistischer Politik nichts zu bieten. In den Händen der herrschenden Klasse und ihrer Intellektuellen ist er nicht mehr als die Aktualisierung des alten, liberalen Extremismus-Theorems, nachdem die beiden Enden des gedachten politischen Spektrums sich wie bei einem Hufeisen annähern. Das hat den enormen Vorteil, dass noch die extremsten Formen des Klassenkampfs von oben – die mörderische Kürzungspolitik in Griechenland oder der permanente Ausnahmezustand in Frankreich etwa – als moderate, vernunftgeleitete Politik der Mitte inszeniert werden können.
Zugleich hat der Populismusbegriff in der europäischen Linken eine neue, eigenständige Dynamik gewonnen. Politische Projekte, denen es im letzten Jahrzehnt gelungen ist, über die Grenzen traditioneller linker Politik erfolgreich zu sein, beziehen sich explizit oder implizit auf populistische Strategien. Die Wahlerfolge von Podemos und der ihr verbundenen stadtpolitischen Bündnisse, die bemerkenswerte Kampagne von Bernie Sanders in den USA, aber auch das respektable Abschneiden von Jean-Luc Mélenchon können als Belege dafür gelten. Linke Intellektuelle wie Oliver Nachtwey legten ein ähnliches Vorgehen auch der deutschen Linken nahe: „Wie könnte man einen Linkspopulismus betreiben, ohne dabei ausgrenzend und protektionistisch zu werden?“1
Um diese Frage zu beantworten, müssten jedoch zunächst die vielen Zuschreibungen und Vorwürfe zur Seite geräumt werden, die die Linkspopulismus-Debatte derzeit überlagern, Wer unter Populismus die kritiklose Übernahme eines scheinbar eindeutigen „Volkswillens“ oder gar die opportunistische Annäherung an rassistische Sicherheits- und Grenzpolitik versteht, wird von dieser Debatte nichts lernen können. Tatsächlich ist es aber notwendig, linken Populismus als real existierendes Phänomen zu verstehen. Denn zumindest wirft er die richtigen Fragen auf, der sich gerade eine klassenkämpferisch orientierte Linke stellen muss. Ich greife hier vier Aspekte thesenhaft heraus.
Erstens: Populismus ist Ausdruck und Bearbeitungsform einer tiefen Krise der Demokratie und des Kapitalismus. Wir erleben heute etwas, das der italienische Kommunist Antonio Gramsci einst mit Blick auf die 1920er und 30er Jahre als „Hegemoniekrise“ oder „Krise der Autorität“ bezeichnet hatte. Stark vereinfacht bedeutet das: Eine große Zahl jener, die sich zum „Volk“ zählen, sieht ihre Interessen, Erfahrungswelten, Selbst- und Weltverständnisse nicht länger im politischen Betrieb und dessen massenmedialer Inszenierung abgebildet. Sie fühlen sich nicht mehr repräsentiert. Die kulturelle Kluft zwischen Volk und Elite öffnet den Raum, in dem der Stoßseufzer abgesetzt wird: „Die da oben machen doch eh was sie wollen.“
Populistische Politik begreift diesen Raum als politisierbar. Sie greift den Unmut auf und behauptet: Wir sind die Stimme des ungehörten Volkes – und wir machen diese Stimme vernehmbar, indem wir den Eliten die Stirn bieten. Die Erfolge von Trump, Brexit, FPÖ oder Front National sind auch auf diese Dynamik der politischen Repräsentationskrise zurückzuführen.
Zweitens: Der linke unterscheidet sich vom rechten Populismus nicht nur darin, wie er die Grenze zwischen „uns“ und „ihnen“ zieht. Linkspopulismus beruht auf einem dem rechten elementar entgegengesetztes Verständnis des „Volkes“. Der rechte Populismus behauptet – und glaubt an – ein authentisches, einheitliches und dem gesunden Menschenverstand zugängliches Interesse des Volkes. Aufgabe der Politik ist es demnach, dem Volksempfinden Gehör zu verschaffen, wie es vor der politischen Einmischung, ursprünglich und unverdorben existierte. Ein linker Populismus dagegen anerkennt die Vielzahl unterschiedlicher, auch gegensätzlicher Interessen, Wünsche, Ansichten und Ängste innerhalb des Volkes. Unterschiedliche Klassenfraktionen, kulturelle Milieus, Positionen in den geschlechterspezifischen, sexuellen, rassistischen und anderen Machtverhältnissen existieren innerhalb des Volkes – nicht, wie die Rechten behaupten, zwischen dem „echten“ Volk und seinen Feinden. Aufgabe der Politik ist es dann, Gemeinsamkeiten herzustellen, temporäre Gemeinschaft und Einheit zu stiften anhand von Forderungen und Begehren, auf die Allianzen der Ausgebeuteten und Unterdrückten sich demokratisch zu einigen vermögen. Damit liegt dieses Verständnis auch quer zu jenen Traditionen des Marxismus, die den objektiven, aber verborgenen gemeinsamen Klasseninteressen bloß zum subjektiven Durchbruch verhelfen zu können glauben. Die Aufgabe ist eine der Allianzenbildung, der Heraufbeschwörung des Gemeinsamen. Das ist mehr als die Addition einzelner Gruppeninteressen oder die Zusammenstellung von Wahlprogrammen nach dem Baukastenprinzip. Die populistische Hypothese lautet, dass die politische Allianz der Unterdrückten durch die Identifikation und Benennung des Gegners gestiftet wird. Entscheidend für einen linken Populismus ist der inklusive Charakter dieser Operation: Wir wollen mehr werden.
Drittens: Ein erfolgreicher linker Populismus weigert sich, die Sprache der Regierenden zu sprechen. Er gibt den Leidenschaften jener Ausdruck, die – wie es Gramsci formulierte – die Initiative der Herrschenden erleiden. Das ist im politischen Tagesgeschäft eine besondere Herausforderung. Denn hier werden wir permanent angehalten, konkrete Lösungen für kleinteilige Probleme zu formulieren. Erwartet werden „konstruktive Vorschläge“ für Problemlagen, deren Formulierung den Ideologen des Kapitals überlassen werden soll. Thomas Goes und David Bednowski haben diese Zumutung jüngst zurecht als „entmündigenden und undemokratischen Impuls“ entlarvt: So wird betont, „wie unerhört kompliziert doch die Sachverhalte und Zusammenhänge der politischen Welt seien – so kompliziert, dass nur Experten und Berufspolitiker sie verstünden“.2 Die Attraktivität linkspopulistischer Projekte ist auch darauf zurückzuführen, dass sie sich dieser Zumutung entziehen. Wenn Podemos das Ende des „Regimes von 1978“ oder Jean-Luc Mélenchon eine Sechste Republik fordert3, wird kommuniziert, dass es um die grundlegende Neugestaltung der institutionellen Bedingungen geht, unter denen Politik gemacht wird. Nicht aus einem radikalen Gestus oder weil konkrete Verbesserungen überheblich geringgeschätzt würden. Sondern als Konsequenz einer pragmatischen Analyse der politischen Verhältnisse. Diese besagt, dass selbst um das Allernötigste zu erreichen ein großer Bruch nötig ist. Für Deutschland übersetzt könnte das heißen: Ein Ende der Drangsalierung von Erwerbsarbeitslosen, ein Stopp für Waffenexporte, eine Garantie für leistbares Wohnen für Alle, die Gewährleistung des Menschrechts auf Asyl oder die Abkehr von der unwiderruflichen Zerstörung unserer ökologischen Lebensgrundlagen. Das sind jetzt schon Kernpunkte unserer Politik. Die populistische Hypothese beinhaltet aber, dass sie unerreichbar bleiben, wenn wir nicht wagen, uns offen gegen das etablierte Parteiensystem zu wenden. Für das Mindeste ist das Gröbste notwendig: Ein großes Nein an den Anfang der eigenen Politik zu stellen.
Viertens schließlich verlangt uns die Diskussion um einen linken Populismus einen Abschied von der Vorstellung rein rationaler Politik ab. Kluge Analysen, gute Argumente und bessere Vorschläge gewinnen nichts in der politischen Auseinandersetzung. Der politische Klassenkampf wird über Erzählungen geführt. Die Herausforderung lautet, Geschichten zu erzählen, die es möglichst vielen verschiedenen Menschen erlauben, ihren Erfahrungen, Wünschen, Sorgen und Begehren darin Sinn zu verleihen. Sie stiften im besten Falle Gemeinschaft und ordnen die notwendige Basisarbeit in Betrieben, Stadtteilen, Schulen und Universitäten in einen größeren Zusammenhang ein. Ihre Botschaft muss im Kern eine der Selbstermächtigung sein. DIE LINKE scheitert an diesem Anspruch, wenn sie ihre Klientel als Schwache und Bedürftige anruft und darauf setzt, sich um sie zu kümmern und sie zu vertreten, statt mit ihnen Kämpfe zu organisieren. „Podemos“ heißt nicht zufällig: „Wir können!“
3 http://mosaik-blog.at/melenchon-frankreich-linke-hamon-le-pen/
_____________________________
Benjamin Opratko ist Politikwissenschaftler und Redakteur von mosaik-blog.at.